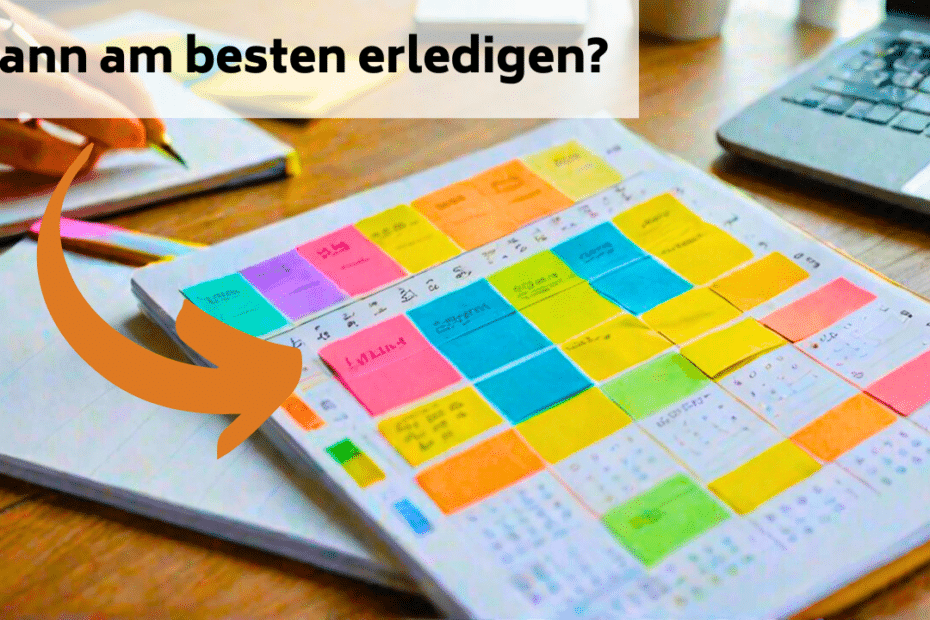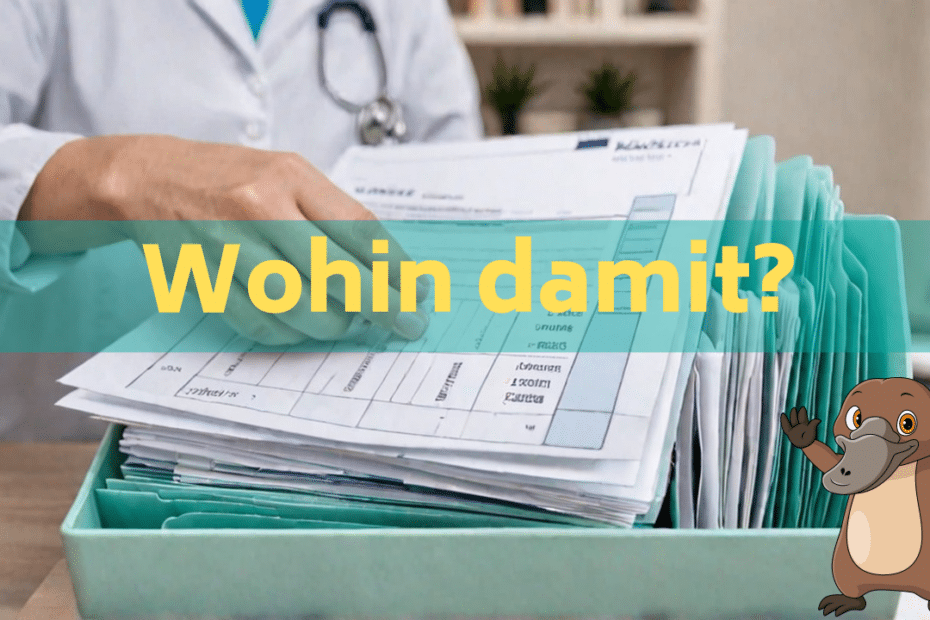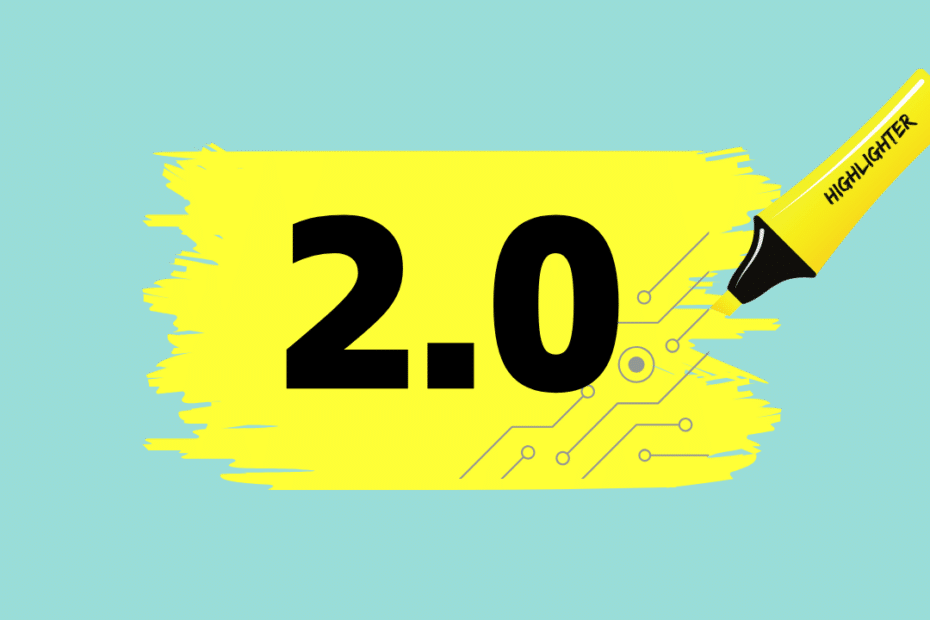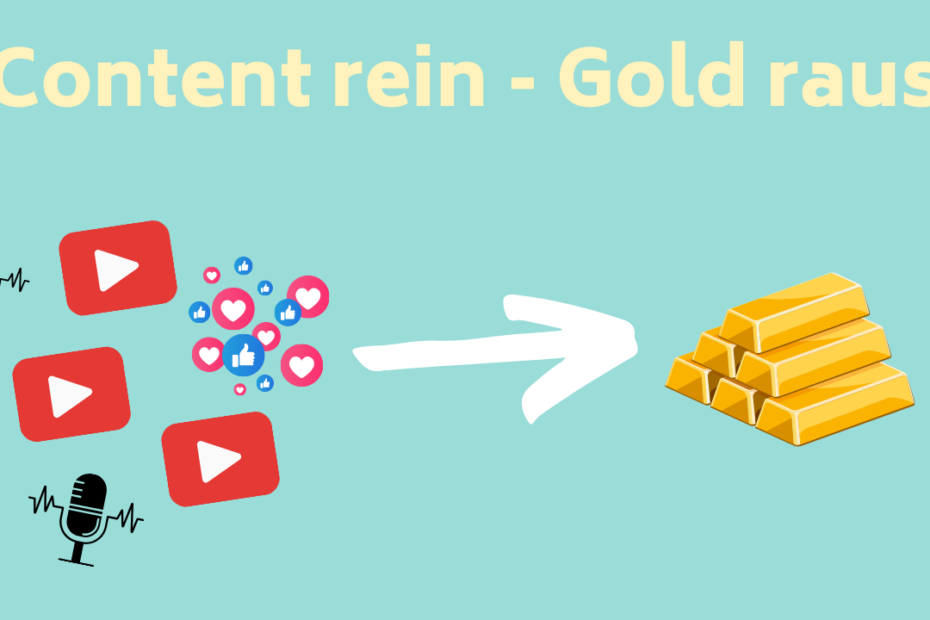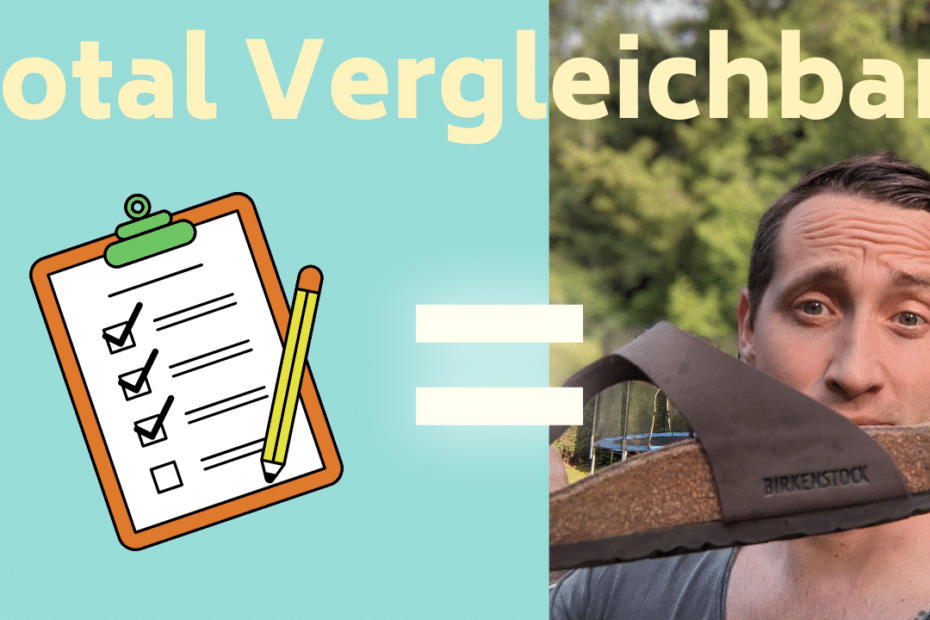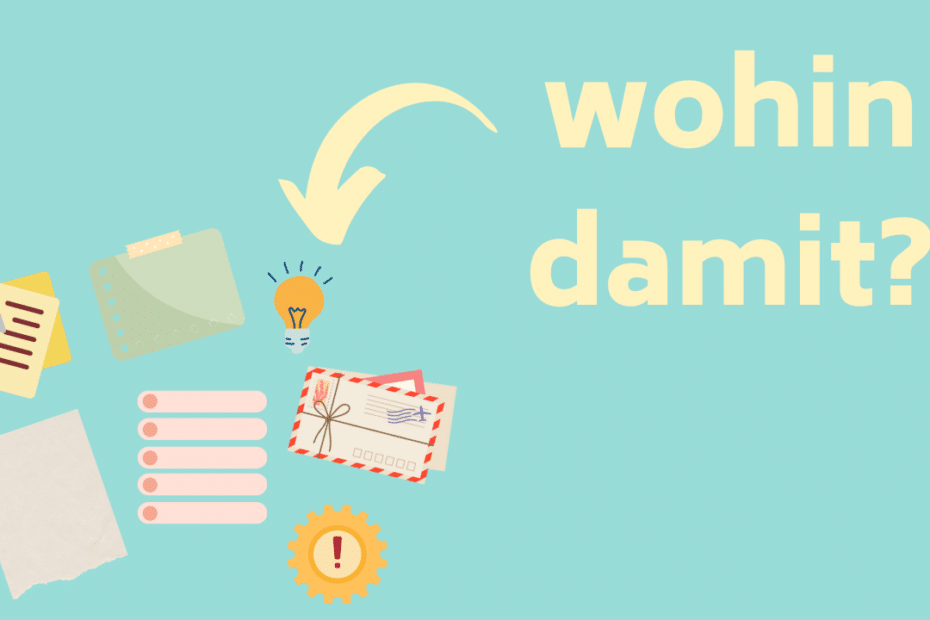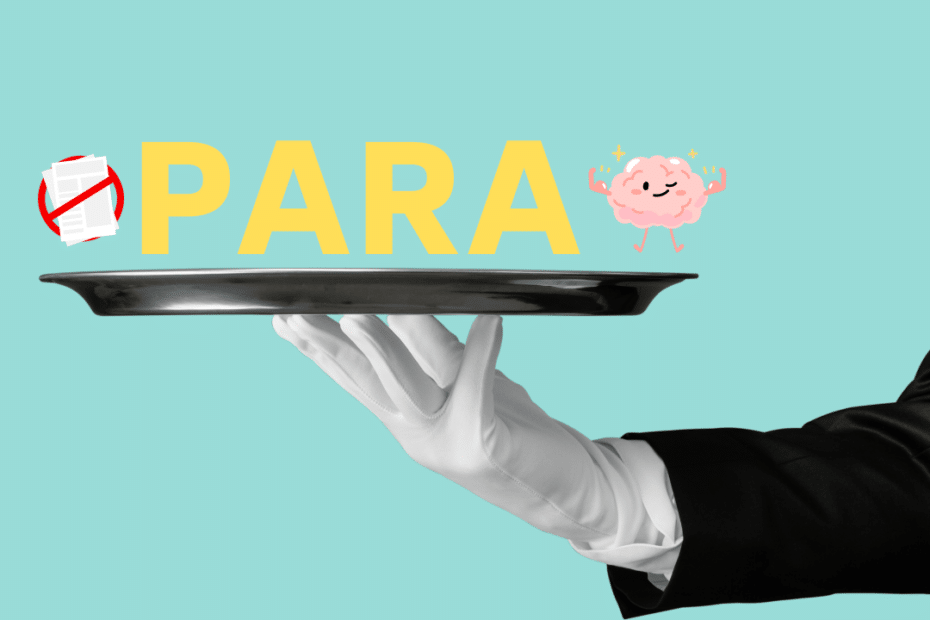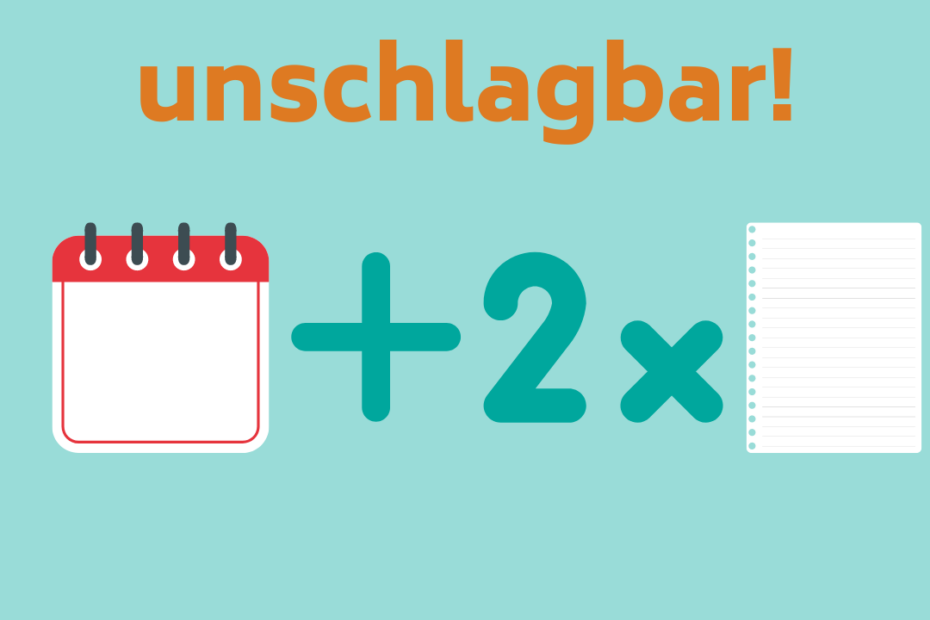Wann sind die nächsten Schritte fällig?
In der heutigen schnelllebigen Welt sind effektive Zeitmanagement-Techniken entscheidend, um die Kontrolle über unsere Aufgaben und Fristen zu behalten. Viele Menschen kämpfen mit traditionellen To-Do-Listen,… Weiterlesen »Wann sind die nächsten Schritte fällig?