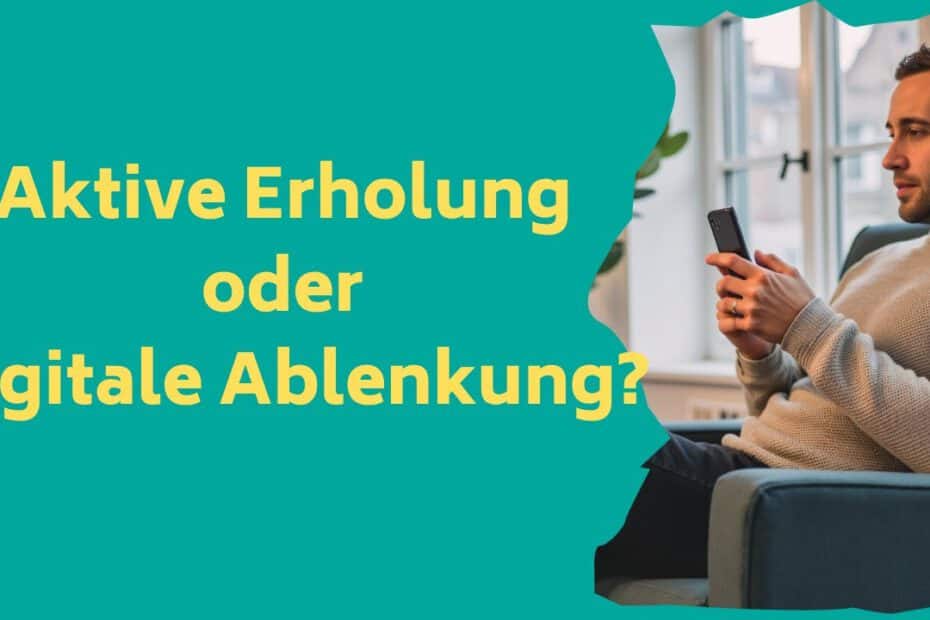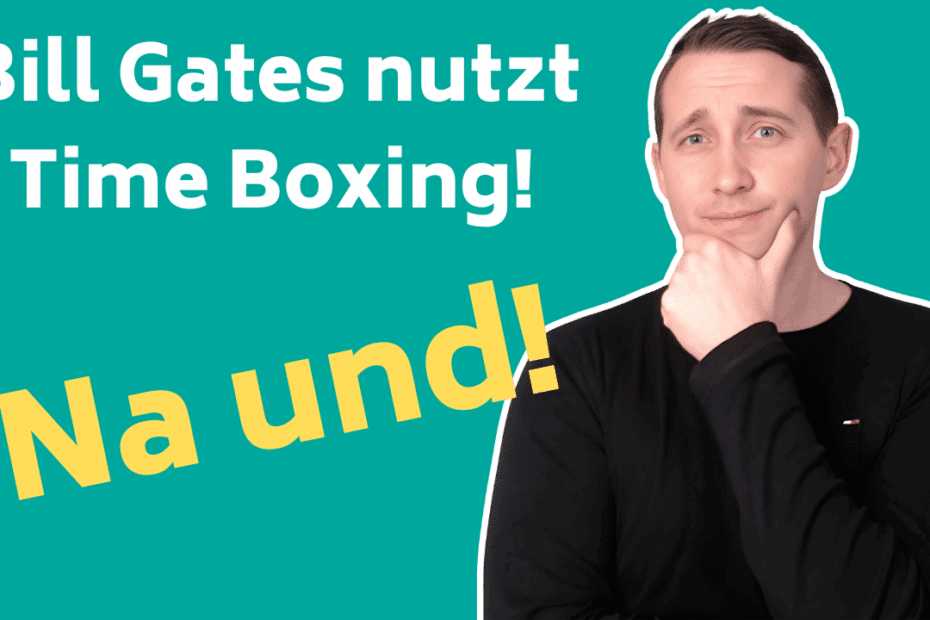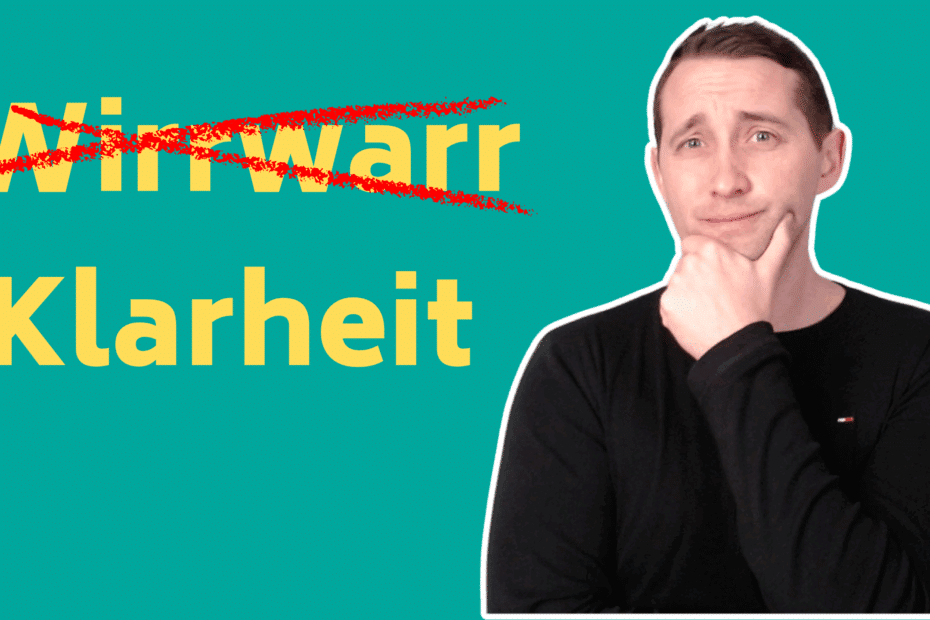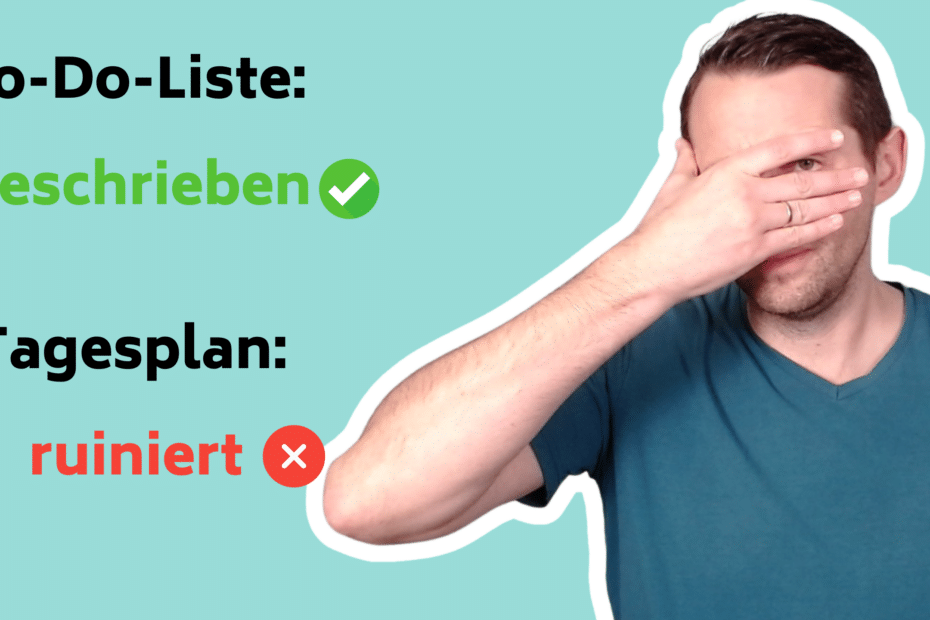Work smarter not harder: Warum Netflix & TikTok dich müde statt erholt machen
Abends pünktlich Feierabend machen und wirklich abschalten – das ist das Ziel, das viele von uns anstreben. Doch statt sich erholt zu fühlen, landen wir nach der Arbeit oft auf der Couch, versinken in Netflix… Work smarter not harder: Warum Netflix & TikTok dich müde statt erholt machen